Bericht aus dem Land namens Auschwitz | Eines der größten Werke der Holocaustliteratur – mit einem Nachwort von Carolin Emcke
Nachdem ich gerade die neue Biografie von Hermann Göring mit großer Faszination gelesen hatte und dir empfohlen hatte, ist es mir ein großes Bedürfnis, gleich nach dieser sehr detaillierten Analyse eines Nazikriegsverbrechers, mir die Auswirkungen des Dritten Reiches in aller Deutlichkeit vor Augen zu führen.
Obwohl ich schon einiges über die Shoa gelesen habe, fand ich den Augenzeugenbericht „Kaltes Krematorium“ schon sehr erschütternd. Ich finde er wird zu Recht mittlerweile zu den größten Werken der Holocaustliteratur gezählt.
Für mich lag das gar nicht so sehr an dem unvorstellbaren Grauenhaftigkeit der darin geschilderten Verbrechen, sondern in der Menschlichkeit des Erzählers József Debreczeni selbst.
1944 wurde der ungarische Journalist und Dichter als Jude nach Auschwitz verschleppt. Er beschreibt seine Reise und die Ankunft im Lager und wie willkürlich dort zwischen Weiterleben und Tod entschieden wird.
Zwölf furchtbare Monate in mehreren Konzentrationslagern folgten, bis er zuletzt im „Kalten Krematorium“, der Krankenbaracke des Lagers Dörnhau, landet. Dort, wie in allen Lagern, gibt es eine spezielle Lagerhierarchie, die entscheidend dafür ist, ob und wie lange man überlebt.
Debreczeni ist dem Tod nah, als das Lager nach dem Einmarsch der Russen und dem Ende des Krieges endlich befreit wird. Kurz danach schreibt er seinen Bericht, der 1950 erstmals auf Ungarisch veröffentlich wird, aber danach in Vergessenheit gerät.
Ist Menschlichkeit noch möglich im „Kalten Krematorium“?
Ich glaube wirklich passagenweise, ich lese einen fiktionalen Text eines modernen, zeitgenössischen Autoren. So lebensnah und aktuell wirken auf mich die Gedanken Debreczenis. Mühelos überwindet sein Text so die Distanz der Zeit. Er spricht direkt zu mir und macht unmissverständlich deutlich, dass diese Hölle real war.
„Nichts anderes zählt. Nur das was hier geschieht. Denn das wovon József Debreczeni erzählt, ist geschehen. Dies wurde Menschen angetan“ schreibt Carolin Emcke in ihrem Nachwort.
Dort hebt sie auch die Einzigartigkeit von József Debreczenis Zeitzeugnis heraus. Und die bestechende Präzision und Beobachtungsgabe, die er als erfahrener Journalist und Schriftsteller berufsbedingt mitbringt.
Was bedeutet Erinnern für uns heute? Sind wir zu sehr mit Phrasen wie „Nie wieder“ beschäftigt, aber wissen eigentlich gar nicht mehr so genau, was da „nie wieder“ passieren soll? Emcke stellt in ihrem Nachwort auch kritische Fragen zu unserer Erinnerungskultur, auf die ich auch keine Antworten habe. Schon längst ist in meiner Wahrnehmung in meinem Umfeld aus dem „Nie wieder“ ein „jetzt muss doch auch wieder mal gut sein“ geworden.
Es ist mir wichtig, in meinen Buchempfehlungen und auf meinem Literatur Blog, aber auch in den Gesprächen mit meinen Kindern und meinen Liebsten werde ich weiterhin von den Zeugnissen und der Literatur von Überlebenden erzählen.
So gibt es auch für „Kaltes Krematorium“ von mir eine dringende Leseempfehlung, wenn du dich diesen Schilderungen von Schrecken und Entmenschlichung gewachsen fühlst.
Das Hardcover erschien bei den S. Fischer Verlagen. Ich habe es als Hörbuch gehört, das von Schauspieler und Sprecher Oliver Dupont gesprochen wird. Passenderweise genauso wie das Hörbuch zu „Hermann Göring – Macht und Exzess“, das ich ebenfalls passagenweise als Hörbuch gehört hatte.
Übersetzt von: Timea Tankó


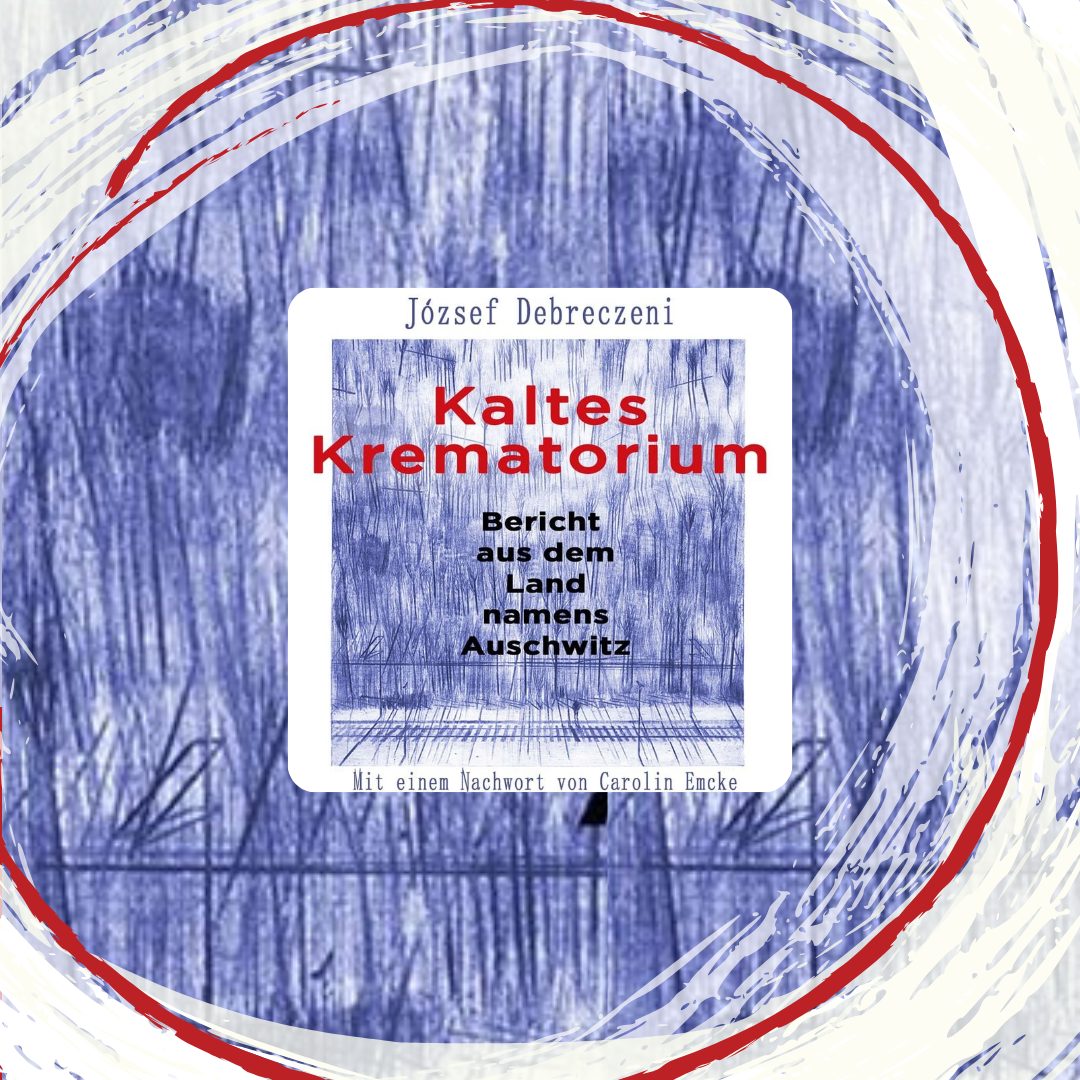
Schreibe einen Kommentar